Weihnachtsaktion
Das ganze Leben liegt nicht mehr vor ihnen
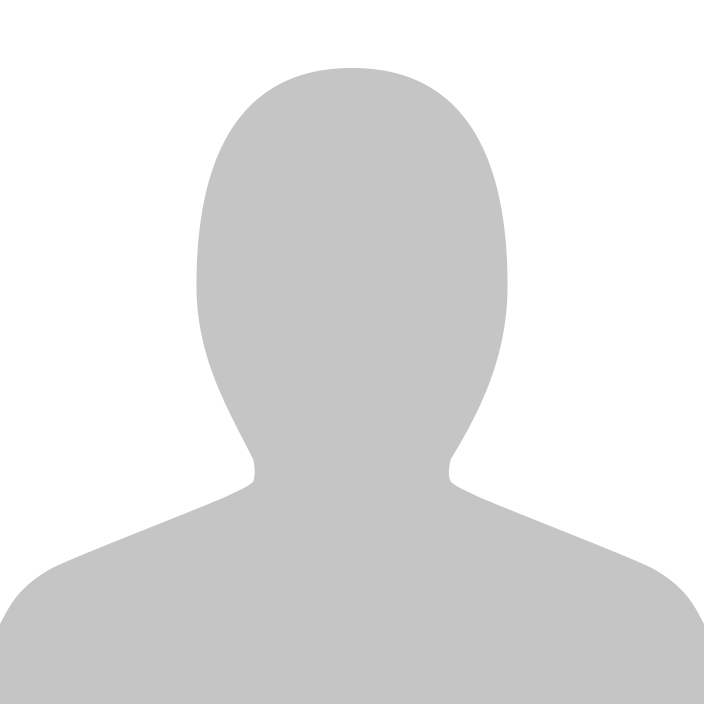
Wie wird man Hospiz- oder Trauerbegleiter? Was muss man wissen? Was ist die Symbolsprache der Sterbenden? Das beantworten die Ausbilderinnen Gizella Smits-Szabo und Marlies Steenken.
Papenburg/Friesoythe - Haben Sie sich schon mal mit Ihrem eigenen Tod auseinander gesetzt? Mit dem Sterben? Wenn Sie Hospizbegleiter oder -begleiterin werden wollen, müssen Sie das. „Und das kann schmerzhaft sein“, weiß Gizella Smits-Szabo. Die gebürtige Ungarin bildet Hospiz- und Trauerbegleiter und -begleiterinnen für das ambulante Kinderhospiz „helpful“ in Papenburg aus, genauso wie Marlies Steenken vom Malteser Hilfsdienst für den ambulanten Hospizdienst Friesoythe – Barßel – Saterland. Das heißt: Die beiden Frauen bilden Ehrenamtliche aus, die Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit begrenzter Lebenserwartung bis zu ihrem Tod und ihre Familien bis zum Tod begleiten. Um Hospizbegleiter zu werden, müssen Interessierte 120 Stunden lernen. Wollen sie noch Trauerbegleiter und -begleiterin werden, kommen mindestens noch mal 80 Stunden oben drauf.
Dabei müssen sie sich anfangs mit dem eigenen Sterben auseinandersetzen. „Sonst kann man Sterbende nicht begleiten“, sagt Gizella Smits-Szabo. Die eigene Motivation werde in einem Vorgespräch abgeklopft. Nur helfen und begleiten wollen, reiche nicht, sagt die Papenburgerin. Denn die Ehrenamtlichen müssten oft einiges aushalten und zum Schluss vor allem Loslassen können. Das weiß die 73-jährige gelernte Krankenschwester aus eigener Erfahrung. Sie habe lange auf der Onkologie, also auf einer Krebsstation gearbeitet, sagt die schmale Frau mit dem hellen Haar. Dabei sah sie, dass sowohl die Kranken als auch die Angehörigen mehr als medizinische Fragen hatten. Sie bildete sich fort, unter anderem an der Malteser-Akademie in Köln, und arbeitete als Lehrschwester.
Von Zorn bis zur Einwilligung
Inzwischen im Ruhestand sei sie „sehr dankbar“, dass sie ihr Wissen bei „helpful“ in Papenburg weitergeben könne, fährt die 73-Jährige fort. Hospiz- und Trauerbegleiter und -begleiterinnen lernen bei ihr, nicht nur sich selbst zu erforschen und eigene Kraftquellen zu nutzen - „Was trägt mich?“ „Steht meine Familie hinter mir?“ - sondern auch Zurückhaltung und Sensibilität. Nur eine gefestigte Person mit Erfahrung könne begleiten, weiß Smits-Szabo. „Es entstehen ja Bindungen.“ Sonst könne es passieren, dass sich zum Beispiel eine junge Mutter bei der Begleitung einer gleichaltrigen, krebskranken Mutter plötzlich sage: „Das kann mir ja auch passieren!“ So eine Identifikation könne(ten) einen aus der Bahn werfen. Deshalb werden zum Beispiel Dialoge geübt, sagt Gizella Smits-Szabo. Die Ausbildung, aber auch Supervisionen, also Gespräche mit Profis, seien unerlässlich, macht die Expertin deutlich. Aber: Beides ist teuer. Dafür braucht „helpful“ zum Beispiel Spenden.
Denn die Begleitung bis zum Tod kann dauern. Sie durchläuft mehrere Stationen, auch „Symbolsprache der Sterbenden“ genannt. Gemeint sind die Phasen des Sterbens, die die Schweizerin und Wahl-Amerikanerin Elisabeth Kübler-Ross (1926 bis 2004) durch ihre Interviews mit Sterbenden formulierte und so die moderne Sterbeforschung begründete. Das lehrt Marlies Steenken in ihrer Ausbildung. Die gebürtige Gehlenbergerin und stellvertretende Leiterin des Malteser Hilfsdienstes in Friesoythe bildet mit Ehrenamtliche aus. Die heute 60-jährige, ebenfalls gelernte Krankenschwester, fing selbst als ehrenamtliche Hospiz- und Trauerbegleiterin an, bevor sie vor sieben Jahren hauptamtlich zum Malteser Hilfsdienst wechselte. Aber zurück zur Symbolsprache der Sterbenden. Kübler-Ross fand heraus, dass sie fünf Phasen durchlaufen:
- Verneinung und Leugnung der Tatsache, dass sie sterben werden,
- Protest und Zorn,
- verhandeln,
- Depression
- Einwilligung
Es gebe „Neid und Enttäuschung“, mit denen alle lernen müssten, umzugehen, weiß Gizella Smits-Szabo aus eigener Erfahrung. Die Phasen seien auch nicht so klar abgegrenzt, wie man denken könne. In Wirklichkeit könnten Begleiter und -begleiterinnen an einem Tag mit einem Sterbenden, der tief depressiv sei, konfrontiert werden, und kurz darauf wieder mit einem zornigen. „Manche springen in den Phasen hin und her.“
Wenn die Hospizbegleiter selbst keine Antwort wissen, lernen sie, wo es Hilfe geben kann: zum Beispiel bei einem Seelsorger oder in einer Selbsthilfegruppe. In der Ausbildung werde nicht nur Wissen, Sensibilität und Stabilität, sondern auch Abgrenzung gelehrt.
„Manche sterben elendig“
Smits-Szabo liegen besonders der Umgang mit Kindern und Jugendlichen, deren Leben begrenzt ist, am Herzen. Zwar gehöre der Tod zum Leben, aber sie könnten nichts aufschieben. „Ihnen kann man nicht sagen: ,Das ganze Leben liegt noch vor dir.‘“ Und so freundlich und verbindlich die Papenburgerin ist, sie beschönigt in ihrem Unterricht nichts. „Manche Menschen sterben wirklich elendig“, weiß die Mutter eines erwachsenen Sohnes. Damit muss man erst mal lernen, mit umzugehen.
Die ambulanten Hospizdienste der Malteser begleiten seit 2012 Kinder, Jugendliche und ihre Familien. Inzwischen gehe sie auch in Schulklassen, sagt Marlies Steenken. Viele Schüler hätten Fragen zu Sterben, Tod und Trauer. Viele Eltern wüssten nicht, wie sie damit umgehen sollten. Viele Kinder treffe es bereits tief, wenn das Haustier gestorben oder ein geliebtes Spielzeug plötzlich weg sei. Anderseits seien Kinder, ob schwer krank oder nicht, oft unbedacht. Manche könnten ihren Sarg aus Spaß am Tun bemalen. Allerdings weiß Steenken auch, dass Kinder erst ab etwa zehn Jahren abstrahieren können, dass Menschen, die tot sind, nicht wieder aufstehen und wiederkommen. In der Ausbildung lernen die Begleiter nicht nur viel über sich selbst, sondern auch Zurückhaltung, Demut und dass der Schwerstkranke im Mittelpunkt steht, „nicht ich“, so Steenken. Selbst der eigene Glaube dürfe keine Rolle spielen. Schließlich hätten sie es manchmal mit Atheisten zu tun. „Was wir wissen und glauben, ist nicht wichtig.“
„Da.sein“ hilft Jugendlichen
Auch Jugendliche zu begleiten, sei nicht immer einfach, weiß Steenken. Viele Schwerstkranke wollten das mit sich oder ihren Freunden ausmachen. Wer trotzdem anonym Gesprächsbedarf hat, dem empfiehlt Steenken die Internetplattform „Da.sein“ des Oldenburger Hospizdienstes.
Das A und O der ehrenamtlichen Hospiz- und Trauerbegleitung sei die Aus- und Fortbildung, ist Smits-Szabo aus Papenburg überzeugt. Obwohl 73 Jahre alt, habe sie 2019 noch eine gemacht – und viel gelernt.



